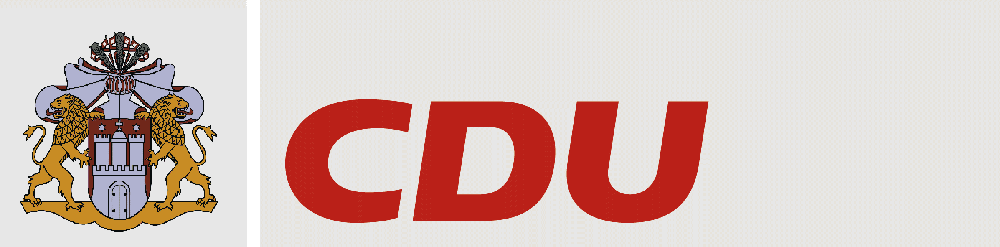Kinder- und Jugenddelinquenz (V)
BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG 16. Wahlperiode
Drucksache
16/5909
27. 04. 01
Schriftliche Kleine Anfrage
des Abgeordneten Klaus-Peter Hesse (CDU) vom 11. 04. 01 und
Antwort des Senats
Betr.: Kinder- und Jugenddelinquenz (V)
In letzter Zeit häufen sich Berichte über ansteigende Zahlen von Kindern und Jugendlichen, die sich prostituieren, drogenabhängig oder delinquent werden. Dabei ist nicht auszuschließen, dass Eltern oder andere Bezugspersonen die durch das Alter bedingte Strafunmündigkeit der Kinder zielgerichtet ausnutzen, um sie für die Begehung von Straftaten zu missbrauchen. Rechtzeitige Hilfe und der gezielte Einsatz staatlicher Maßnahmen können bewirken, dass diesen Kindern und Jugendlichen Perspektiven aufgezeigt werden, die sie aus ihrer schwierigen und scheinbar aussichtslosen Lebenssituation herausführen. Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat. Die Beschäftigung mit dem Thema Jugenddelinquenz ist in den letzten Jahren zunehmend zum Thema der öffentlichen Debatte in Hamburg und in der Bundesrepublik, aber auch anderen Staaten geworden. Für eine sachgerechte Bewertung gilt es, sich hierzu einige grundlegende Zusammenhänge vor Augen zu führen: Rund 95 Prozent der in Hamburg wohnenden unter Einundzwanzigjährigen tauchen nicht als Tatverdächtige in der jährlichen Polizeilichen Kriminalstatistik auf. Ein großer Teil der Delikte von Kindern und Jugendlichen sind z.B. Leistungserschleichung, Ladendiebstahl und Sachbeschädigung. Dahinter steht zu einem großen Teil ein auf eine kurze biographische Phase beschränktes, vorübergehendes „Grenzen überschreiten“. Hier ist in erster Linie auch die erzieherische Reaktion aus dem „sozialen Nahraum“, also vor allem seitens der Sorgeberechtigten gefragt. Bei einer geringeren Zahl Jugendlicher setzt sich dieses Verhalten allerdings fort. Hier müssen schnelle und normverdeutlichende Reaktionen staatlicher Institutionen greifen, bevor sich „kriminelle Karrieren“ verfestigen. Dies gilt in besonderer Weise, wenn Gewalttaten verübt werden. Hierbei sind allerdings die Größenordnungen zu beachten: Nach wie vor entfällt nur ein geringer Teil der von unter einundzwanzigjährigen Tatverdächtigen begangenen Taten auf den Bereich der Gewaltdelikte. Die Anzahl dieser unter einundzwanzigjährigen Tatverdächtigen hat im längerfristigen Trend der letzten Jahre allerdings insbesondere im Bereich der Straßenraubdelikte deutliche Steigerungen erfahren, wobei die Taten zu einem großen Teil von männlichen Jugendlichen gegenüber Gleichaltrigen begangen werden. Bei der Bewertung dieser Entwicklung ist zu berücksichtigen, dass das Anti-Raub-Konzept der Polizei sowie Präventionskampagnen von Polizei, Schulen und Jugendhilfe gezielt darauf ausgerichtet sind, die Anzeigebereitschaft zu erhöhen. Die in den neunziger Jahren in Hamburg wie im Bundesgebiet feststellbaren Veränderungen der Jugendkriminalität haben den Senat 1998 veranlasst, den staatlichen Umgang mit Jugendkriminalität in Hamburg zu überprüfen und weiter zu entwickeln. Hierbei orientiert sich der Senat an den folgenden Leitlinien: 1. Wissen verbessern Für eine gezielte und angemessene Reaktion auf Jugenddelinquenz bedarf es gesicherten Wissens und wissenschaftlicher Erkenntnisse über Ausmaß und Ausprägung der Delinquenz. Amtliche Statistiken wie z.B. die Polizeiliche Kriminalstatistik liefern hierzu Beiträge, reichen aber für eine realistische Einschätzung der genannten Entwicklungen nicht aus. Der Senat hat deshalb unter anderem wissenschaftliche Dunkelfeldstudien und Aktenanalysen zur Reaktion auf Jugenddelinquenz gefördert.
Bürgerschaftsdrucksachen – außer Senatsvorlagen – sind – gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier – zu beziehen bei: Druckerei Wartenberg & Söhne GmbH, Theodorstraße 41 w, 22761 Hamburg, Telefon 89 97 90 - 0
Drucksache 16/5909
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode
2. Vernetzung von Prävention und Repression Für die Reaktion auf Jugenddelinquenz sind mehrere Behörden und Institutionen zuständig. Eine Beschränkung auf Maßnahmen der Polizei und Justiz wäre nicht sachgerecht. Um die Arbeit und Zusammenarbeit dieser unterschiedlichen Bereiche und Kompetenzen zu optimieren, hat der Senat die behördenübergreifende Kooperation verbessert und in diesem Rahmen unter anderem eine Überregionale und sieben Bezirkliche Fachkommissionen „Jugendhilfe, Schule, Polizei und Justiz“ eingerichtet. 3. Schnelle und normverdeutlichende Reaktion Jungen Straftätern und Straftäterinnen muss im Rahmen des geltenden Rechts gezeigt werden, dass sie für ihre Taten verantwortlich sind und diese Taten nicht folgenlos bleiben. Eine solche Reaktion muss konsequent und zügig erfolgen. Polizei, Justiz und Jugendstraffälligenhilfe handeln nach dieser Maxime. Hierzu gehören auch die im Rahmen der von der Justiz- und Innenbehörde durchgeführten Beschleunigungskonferenz erreichte Verkürzung der Verfahrensdauern und das vor allem auf tatzeitnahe Ermittlung und normverdeutlichende Gespräche mit Tatverdächtigen und deren Sorgeberechtigten setzende Anti-Raub-Konzept der Polizei. 4. Soziale Integration verbessern Zahlreiche junge Menschen, die Straftaten begehen, haben mangelnde soziale und berufliche Perspektiven. Hier können unterschiedliche Politikfelder, Institutionen, aber auch die Gesellschaft insgesamt dazu beitragen, dass junge Menschen unter positiven Rahmenbedingungen aufwachsen – in Familie, Schule und Ausbildung, in ihrem Stadtteil und in der Freizeit. Zur Reaktion des Senats auf die Empfehlungen des im Vorjahr vorgelegten Berichts der Enquete-Kommission „Jugendkriminalität und ihre gesellschaftlichen Ursachen“ siehe auch Drucksache 16/5498. Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt.
1. Wie hat sich im Jahr 2000 die Kinder- und Jugendkriminalität entwickelt? (Bitte Beantwortung der Frage wie folgt: analog Drucksache 16/1462, Frage 1: Wie hat sich die Kinder- und Jugendkriminalität, differenziert nach den verschiedenen Alters- und Deliktsgruppen, entwickelt? Bitte zusätzlich nach Deutschen bzw. Nichtdeutschen aufgliedern.) Die Entwicklung der Kriminalität der unter Einundzwanzigjährigen wird in der Anlage 1 dokumentiert. Die Gestaltung der in Anlage 1 aufgeführten Tabellen orientiert sich hinsichtlich des Deliktspektrums an den bereits in der Drucksache 16/1462 abgefragten Deliktsbereichen. Zusätzlich sind jeweils weitere Tabellen, gegliedert nach deutschen und nichtdeutschen Tatverdächtigen, beigefügt.
2. Wie viele jugendliche Mehrfachtäter gab es im Jahr 2000? (Bitte Beantwortung analog Drucksache 16/5201, Frage 1, differenziert nach Alters-, Deliktsgruppen, Geschlecht und deutsche bzw. nichtdeutsche Täter.) Die Angaben zu den jugendlichen Mehrfachtätern, differenziert nach Alters-, Deliktsgruppen, Geschlecht und deutsche bzw. nichtdeutsche Tatverdächtige, ergeben sich aus den in der Anlage 2 aufgeführten Tabellen. Die Gestaltung dieser Tabellen orientiert sich an der Darstellung in der Drucksache 16/5201.
3. Wie viele minderjährige Prostituierte, drogenabhängige, obdachlose oder auffällig delinquente Kinder und Jugendliche sowie minderjährige Asylbewerber im Alter bis zu 14 Jahren und im Alter von 14 bis 18 Jahren wurden im Jahr 2000 von der Polizei aufgegriffen? (Bitte getrennt aufschlüsseln nach Personen- und Altersgruppe.) a) Wie wurde mit ihnen verfahren, welche konkreten Maßnahmen wurden ergriffen und von wem? b) Welche Nationalität hatten die aufgegriffenen Personen bzw. welcher ethnischen Minderheit gehörten sie an? c) Welches Geschlecht hatten die aufgegriffenen Personen? Die erfragten Daten werden statistisch nicht gesondert erfasst. Die Ermittlung der erwünschten Zahlenangaben würde eine manuelle und individuelle Auswertung sämtlicher bei der Polizei vorhandener Anzeigen, Berichte usw. des Jahres 2000 notwendig machen, die sich an den in der Frage vorgegebenen Kriterien orientieren müsste; dieses ist in der für die Beantwortung der Schriftlichen Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit mit vertretbarem Aufwand nicht möglich. Werden Kinder oder Jugendliche des in der Frage genannten Personenkreises von der Polizei aufgegriffen, so werden sie den Personensorgeberechtigten oder, sofern diese nicht zu erreichen sind, dem Kinder- und Jugendnotdienst des Amtes für Jugend (KJND) übergeben. Bei erheblicher Gefährdung des Kindeswohls, das bei dem in Frage stehenden Personenkreis häufig vorliegt, ist der Allgemeine Soziale Dienst der bezirklichen Jugendämter bzw. der KJND zu unterrichten. Die Jugendhilfe leitet die erforderlichen Maßnahmen ein. Hierzu können unter anderem eine Inobhutnahme bzw. Herausnahme des Minderjährigen nach § 42 bzw. § 43 SGB VIII, die Bewilligung einer Hilfe zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII, die Anrufung eines Familiengerichts nach § 50 SGB VIII sowie weitere geeignete Maßnahmen gehören. Grundsätzlich steht das in der Antwort zu 4. beschriebene Hilfespektrum der Jugendhilfe zur Verfügung. 2
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode
Drucksache 16/5909
4. Welche konkreten Hilfsangebote und Maßnahmen sind generell für die jeweiligen Personenkreise im Alter von bis zu 14 Jahren von welchen Einrichtungen und Trägern vorgesehen? Aufgabe der Erziehungsberatungsstellen ist es, frühzeitig Kinder, Jugendliche und deren Eltern bei der Lösung von Konflikten zu beraten, Klärungen herbeizuführen, Fördermaßnahmen und neue Lebensperspektiven zu entwickeln. Neben der diagnostischen Kompetenz verfügen die Erziehungsberatungsstellen über vertiefte therapeutische Kenntnisse (Familientherapie, tiefenpsychologische Verfahren, Spieltherapie, Verhaltenstherapie, psychomotorische Übungsbehandlungen). 3826 Familien haben im Jahr 1999 die Hilfe einer der 14 städtischen Erziehungsberatungsstellen in Anspruch genommen. Überwiegend ältere Kinder und Jugendliche mit gravierenden Verhaltensauffälligkeiten, Schulverweigerungshaltungen, psychischen Problemen, Störungen im Legalverhalten und Konflikten mit den Eltern können einen Erziehungsbeistand erhalten. Erziehungsbeistände sind überwiegend Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Sie stehen den Kindern und Jugendlichen als verlässliche erwachsene Bezugsperson außerhalb der eigenen Familie zur Verfügung. Im Durchschnitt des Jahres 2000 wurden 947 Erziehungsbeistände bewilligt. Verhaltensauffälligkeiten, Schulprobleme, psychische Störungen, Umhertreiben und Weglaufen oder Auffälligkeiten im sexuellen Bereich sind oft Gründe für eine Unterbringung in einer stationären Einrichtung. Hilfen in Einrichtungen von Hamburger Trägern werden in der Regel für Gruppen von sechs bis acht Kindern bzw. Jugendlichen organisiert. Aspekte der Gruppenpädagogik spielen in der Alltagsgestaltung eine wichtige Rolle. Im Durchschnitt des Jahres 2000 waren 1960 Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung untergebracht. Für besonders belastete und mit den üblichen pädagogischen Methoden und Hilfeangeboten nicht (mehr) erreichbare Jugendliche werden intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen eingerichtet. Eine pädagogische Fachkraft kümmert sich 20 oder mehr Stunden für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten bis zu einem Jahr um den einzelnen Jugendlichen. Im Durchschnitt des Jahres 2000 erhielten 198 Jugendliche eine intensive sozialpädagogische Einzelmaßnahme. Für einzelne Problemlagen stehen besondere Einrichtungen zur Verfügung. Unter vierzehnjährige Drogenabhängige haben bei Bedarf die Möglichkeit, sich einer Entgiftung in der Abteilung „Kinder- und Jugendentzug“ der Fachklinik Bokholt zu unterziehen sowie an einer stationären Drogentherapie im „COME IN“ teilzunehmen. Träger der beiden Einrichtungen ist der Verein „Therapiehilfe e.V.“. Im „COME IN“ stehen für die erste Therapiephase, die in der Regel zwölf Monate dauert, 20 Plätze zur Entwöhnung und Rehabilitation und für die zweite Reintegrationsphase zehn Plätze zur Verfügung. Im Jahr 2000 wurden im „COME IN“ zwei unter Vierzehnjährige aufgenommen, die nicht aus Hamburg kamen. In der Abteilung „Kinder- und Jugendentzug“ der Fachklinik Bokholt stehen zwölf Planbetten zur Verfügung. Drogenabhängige Kinder und Jugendliche haben hier die Möglichkeit, sich zwischen zwei und sechs Wochen, in Ausnahmefällen auch bis zu drei Monate, medizinisch-therapeutisch behandeln zu lassen. Im Jahr 2000 wurden zwei unter Vierzehnjährige mit einer Hamburger Wohnadresse aufgenommen. In den beiden genannten Einrichtungen werden auch Kinder und Jugendliche aus anderen Bundesländern aufgenommen, so dass der Grad der Auslastung nichts über die Situation von minderjährigen Drogenabhängigen aus Hamburg aussagt. Hamburger Drogenabhängige werden jedoch in beiden Einrichtungen bevorzugt aufgenommen. Darüber hinaus erprobt die zuständige Behörde mit dem Modellprojekt PILOT einen Handlungsansatz zur Verbesserung des Zugangs von helfenden Institutionen zu Familien und zur schnelleren und wirksamen Unterstützung bei delinquentem Verhalten von Kindern (siehe Drucksache 16/2805, „Weiterentwicklung der Handlungsmöglichkeiten als Reaktion auf delinquentes Verhalten von Kindern und Jugendlichen in Hamburg“). Das Modellprojekt soll zur Optimierung der Zusammenarbeit unterschiedlicher Arbeitsbereiche der Jugendhilfe unter Einschluss der Familiengerichte beitragen. Das im Bezirk Hamburg-Nord angesiedelte Modellprojekt ist bis zum 31. Dezember 2001 befristet. Ein Erfahrungsbericht soll im Jahr 2002 vorgelegt werden.
5. Wie verbindlich sind diese Angebote? a) Ist eine vorübergehende verbindliche Unterbringung vorgesehen? c) Gibt es eine verbindliche pädagogisch-therapeutische Behandlung? Das Leben und die Betreuung in stationären Einrichtungen ist generell mit einem hohen Maß an Verbindlichkeit verknüpft. Verbindlichkeit in der Betreuung bedeutet, dass sowohl der Tages- als auch der Wochenablauf in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht geregelt sind. Dies bezieht sich auf alle Aktivitäten und Unternehmungen, so z.B. auf die Zeiten für die Einnahme der Mahlzeiten oder für den Zeitraum, in dem schulische Hausaufgaben zu erledigen sind, aber auch auf die Freizeitaktivitäten. Es ist Aufgabe der Pädagogen, auf das Einhalten der verbindlich vereinbarten Absprachen und Regelungen zu achten. Bei entsprechenden Verstößen erfolgen sachlich angemessene Sanktionen.
6. Wie viele Plätze gibt es in diesen Einrichtungen und wie hoch ist die Auslastung? Bei Hamburger Trägern stehen knapp 1600 Plätze in stationären Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung zur Verfügung. Die Regelauslastung der Einrichtungen liegt zumeist bei 95 Prozent. Detaillierte Informationen zu dem Grad der Auslastung gehören zum Betriebs- und Geschäftsgeheimnis der Träger der Hilfen zur Erziehung und können nicht mitgeteilt werden. 3
Drucksache 16/5909
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode
7. Wie lang ist im Durchschnitt die Aufenthaltsdauer der Kinder in diesen Einrichtungen und welche Anschlussmaßnahmen werden vorgehalten? Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Kindern und Jugendlichen in den Hamburger Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung – aufgeschlüsselt nach den einzelnen Hilfeformen – für das Jahr 2000 ist folgender Tabelle zu entnehmen. Durchschnittliche Verweildauer in Tagen1 § des SGB VIII § 28 § 29 § 30 § 31 § 32 § 33 § 34 § 35 § 35 a
1
Inhalt Erziehungsberatung Soziale Gruppenarbeit Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer Sozialpädagogische Familienhilfe Erziehung in einer Tagesgruppe Vollzeitpflege Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
2000 128 197 125 125 164 558 281 104 472
Die Verweildauer wie folgt errechnet: Die Hilfen zur Erziehung werden in einer verwaltungsinternen Datenbank registriert. Bei jeder in 2000 beendeten Hilfe wurde die Dauer zwischen dem Hilfebeginn und dem Hilfeende errechnet. Im nächsten Schritt wurde aus der Grundgesamtheit dieser Daten das statistische Mittel der Hilfedauer nach Hilfearten gebildet. Die Betreuungsverläufe sind den pädagogischen Notwendigkeiten des Einzelfalls angepasst und gestalten sich individuell verschieden. Grundsätzlich stehen das gesamte Spektrum der Hilfen zur Erziehung sowie andere Hilfen als Anschlussmaßnahmen zur Verfügung. 8. In welchem Maße werden diese Kinder psychiatrisch betreut? Für psychotherapeutische Behandlung und Beratung stehen in allen Bezirken Erziehungsberatungsstellen zur Verfügung. Sofern psychiatrische Diagnose und Therapie erforderlich ist, kann auf das Netz jugendpsychiatrischer Dienste in Hamburg (jugendpsychiatrische Dienste in den Bezirken, jugendpsychiatrischer und jugendpsychologischer Dienst des Amtes für Jugend für stationäre Hilfen zur Erziehung) zurückgegriffen werden. Stationäre psychiatrische Behandlung erfolgt in den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Kliniken. Darüber hinaus stehen das gesamte Versorgungssystem der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie Psychologinnen und Psychologen mit fachärztlicher und psychotherapeutischer Qualifikation für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. 9. Wie ist gewährleistet, dass hoch qualifiziertes Personal in einem ausreichenden Betreuungsschlüssel für diese Kinder zur Verfügung steht? Wie häufig wird das Personal fortgebildet? Die Träger der erlaubnispflichtigen sozialpädagogischen Einrichtungen sind verpflichtet, der zuständigen Behörde die Namen und die berufliche Ausbildung der Leiterin bzw. des Leiters und der Betreuungskräfte mitzuteilen (§ 47 Absatz 1 SGB VIII). Die Betreuungsschlüssel sind zwischen der zuständigen Behörde und den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege ausgehandelt worden. Der Betreuungsschlüssel für stationäre Hilfen beträgt 1: 2,15 und ist ausreichend. Eine kontinuierliche Fortbildung ist unerlässliche Voraussetzung für die Erhaltung und Verbesserung der Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die zuständige Behörde trägt durch ein umfangreiches Fortbildungsprogramm zur Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendhilfe bei. Daneben verfügen auch einzelne freie Träger der Jugendhilfe über eigene Fortbildungsinstitute und -maßnahmen. Die Häufigkeit der Fortbildung wird durch die einzelnen Träger und durch die Initiative der Fachkräfte bestimmt. 10. Gibt es regelmäßige Qualitätskontrollen der Träger und Einrichtungen? Wenn ja, wie häufig und in welchem Umfang finden Kontrollen statt? Wenn nein, warum nicht? Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung benötigen grundsätzlich eine Erlaubnis zum Betrieb und unterliegen der örtlichen Prüfung nach § 46 SGB VIII. § 78 b SGB VIII und der Hamburger Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII fordern den Abschluss von Qualitätsentwicklungsvereinbarungen zwischen der zuständigen Behörde und den einzelnen Trägern der Jugendhilfe als Voraussetzung für die Übernahme der Kosten im Einzelfall. Jährlich finden Qualitätsentwicklungsgespräche zwischen den bezirklichen Jugendämtern und den einzelnen Trägern statt. 11. Welche Bedeutung misst der Senat der Kinderpsychiatrie in diesem Zusammenhang zu? Delinquenz von Kindern und Jugendlichen ist für sich genommen keine Indikation für eine ambulante und/oder stationäre psychiatrische Behandlung. Wenn Kinder und Jugendliche psychisch krank und auch delinquent sind, steht ihnen das gesamte Spektrum kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlung zur Verfügung. Hierzu zählen bei stationärer oder teilstationärer Behandlungsbedürftigkeit auch die klinischen Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie. 11. a) Wie viele Plätze sind in der Kinderpsychiatrie vorgesehen? Der Krankenhausplan 2005 sieht weitere 24 vollstationäre Betten und acht teilstationäre Behandlungsplätze in einer neu aufzubauenden klinischen Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Hamburger Süden sowie die Erhöhung der Kapazitäten am Universitäts-Krankenhaus Eppendorf um zwei vollstationäre Betten vor. Insgesamt stehen dann einschließlich des Angebotes für den Drogenentzug bei Kindern und Jugendlichen 104 Betten und 23 teilstationäre Behandlungsplätze zur Verfügung.
4
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode 11. b) Wie ist die Auslastung der Kinderpsychiatrie?
Drucksache 16/5909
Laut Krankenhausstatistik war die kinder- und jugendpsychiatrische Abteilung am Universitäts-Krankenhaus Eppendorf in 2000 zu 91,5 Prozent ausgelastet, die kinder- und jugendpsychiatrische Abteilung am Katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelmstift zu 95,5 Prozent. 12. Welche Konzepte sieht der Senat zur Bekämpfung von Kriminalität, Prostitution, Drogenabhängigkeit und Obdachlosigkeit von Kindern vor? Die Polizei wird im Rahmen des Jugendschutzes oder bei anlassbezogenen Überprüfungen im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips nach dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOG) tätig, trifft erste Sofortmaßnahmen und schaltet die Fachdienststellen der Jugendhilfe ein. In Bezug auf Drogenabhängigkeit gilt dies insbesondere im Rahmen des Handlungskonzeptes St.Georg sowie im Rahmen der Tätigkeiten der Dienstgruppe Jugendschutz der PD Mitte im Bereich des Hamburger Hauptbahnhofs. Gleiches gilt grundsätzlich auch bei Straftaten, die von strafunmündigen Kindern verübt werden. Darüber hinaus verweist die Polizei in erster Linie auf Maßnahmen der zuständigen staatlichen Jugendhilfe, freier Träger und – bei minderjährigen Drogenabhängigen – zusätzlich auf Hilfsangebote von Suchtberatungsstellen. Konzeptionell wird bei der Polizei ein Schwergewicht darauf gelegt, spezielle Funktionen mit Fachwissen für den Bereich Kinder- und Jugenddelinquenz zu schaffen und zu erhalten. Zu nennen sind hier die Jugendbeauftragten, die Jugendsachbearbeiterinnen und Jugendsachbearbeiter sowie die Dienststellen Jugendschutz mit einer zentralen Fachaufsicht im LKA. Im Bereich der allgemeinen Prävention von Jugendkriminalität führt die Polizei in Kooperation mit dem Amt für Schule seit 1981 das „Präventionsprogramm Kinder- und Jugenddelinquenz“ durch. Im Rahmen dieses Programms stehen in Hamburg derzeit rund 50 ausgebildete Präventionsbeamtinnen und Präventionsbeamte zur Verfügung, die außerhalb ihrer Dienstzeit im Nebenamt Schulklassen aller Altersstufen und Schulformen besuchen und mit der Lehrkraft Unterrichtseinheiten zu Fragen der Jugendkriminalität durchführen. In den letzten Monaten wurde das Thema Jugendgewalt im Rahmen einer Kampagne „Gemeinsam gegen Gewalt“ verstärkt in den Unterricht einbezogen. Durch die als „Handy-Aktion“ bekannt gewordene Präventions-Kampagne, die von September bis Ende 2000 lief, wurde das bei Jugendlichen verbreitete Raubobjekt „Handy“ im Schulunterricht als Einstieg für Gespräche zum Thema „Gewalt unter Jugendlichen“ genutzt. In diesem Kontext erhielten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die Individualnummer (IMEI-Nummer) des in ihrem Besitz befindlichen Handys in eine persönliche Informations- und Registrierkarte einzutragen. Diese Karten waren an den Hamburger Schulen und Polizeidienststellen erhältlich. Die Aktion zeigt sowohl in den Schulen als auch in der breiten Öffentlichkeit eine äußerst positive Resonanz. Bis zum Jahresende 2000 wurden an 79 Hamburger Schulen (ca. 10 000 Schülerinnen und Schüler) themenbezogene Präventionsunterrichte von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gegeben. Vor diesem Hintergrund werden entsprechende Unterrichtseinheiten auch im Jahre 2001 fortgeführt. Der Senat hat in der Drucksache 16/5530 („Entwicklung und Situation von minderjährigen Drogenabhängigen in Hamburg“) Stellung zum Umgang mit drogenabhängigen Minderjährigen genommen und ist in diesem Zusammenhang auch auf die niedrigschwelligen Angebote für sich prostituierende Minderjährige und Straßenkinder eingegangen. 13. Wie häufig und in welchem Umfang wurde das Konzept des Kinder- und Jugendhilfe-Notdienstes (KJND) überprüft und verändert, um es den jeweiligen gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen? Die Arbeit des KJND wird detailliert dokumentiert und laufend überprüft. Die Konzepte des KJND werden auf der Grundlage der Überprüfungen und der daraus abgeleiteten Fachdiskussionen ständig weiterentwickelt. Unter anderem wurden umfangreiche konzeptionelle Weiterentwicklungen eingeleitet im Zusammenhang mit – der Problematik der Misshandlung und des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen (quantitative und qualitative Angebotsverbesserung), – der gestiegenen Inanspruchnahme durch Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien (Fortbildung der Mitarbeiterschaft, stärkere Berücksichtigung kultureller Faktoren), – dem vorübergehenden Anstieg der Zahl alleinreisender minderjähriger Flüchtlinge Mitte der Neunzigerjahre (Verlagerung der Zuständigkeiten vom KJND auf Erstversorgungseinrichtungen), – der Drogen- und Aidsproblematik (Mitarbeiterqualifizierung, Vorbereitung und Begleitung zum Entzug, Schutz vor Infektion, Ausstieg), – der zunehmenden Bereitschaft von Kindern und Jugendlichen, zur Durchsetzung ihrer Interessen im Zusammenleben mit Gleichaltrigen Gewalt anzuwenden (Verbesserung der pädagogischen Konzepte zum Erkennen der Gewaltbereitschaft und zur wirksamen Intervention). 14. Gab es seit Einrichtung des KJND Beschwerden von Anwohnern, die sich auf die Tätigkeit des KJND bezogen? Wenn ja, wann, wo, aus welchem Anlass und wie wurde darauf reagiert? Vereinzelte Beschwerden gibt es hin und wieder seit Einrichtung des KJND. Eine Häufung gab es 1998, als von mehreren Anwohnern eine unzureichende Beaufsichtigung der Kinder und Jugendlichen vorgeworfen wurde. Anlass waren unter anderem eine zunehmende Zahl von Sachbeschädigungen an Autos in der Umgebung der Einrichtung sowie andere Vorfälle. Es wurde vermutet, dass diese Taten von Bewohnern des KJND ausgeübt wurden. Zur Klärung der Probleme wurde ein „Runder Tisch“ durchgeführt. Beteiligt waren Anwohner des KJND, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KJND, Beamtinnen und Beamte des zuständigen Polizeireviers sowie als Beobachter ein Vertreter der Wissenschaftsseite. 5
Drucksache 16/5909
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode
Dabei berichtete die Polizei, dass – entgegen den Vermutungen – die gehäuften Sachbeschädigungen an den Autos nicht von Bewohnern des KJND durchgeführt wurden. Der KJND berichtete, dass, soweit es sich bei den anderen Vorfällen um Kinder oder Jugendliche aus dem KJND gehandelt habe, in jedem Falle mit dem betreffenden Kind oder Jugendlichen über ihre Tat, deren Folgen und Möglichkeiten der Wiedergutmachung gesprochen wurde. Erforderlichenfalls seien Verbote bzw. Gebote zum Ausgang und Umgang ausgesprochen worden. In Schadensfällen sei veranlasst worden, dass die Täter sich entschuldigen und einen Ausgleich anbieten. Da auch in Zukunft Belästigungen von Bewohnern durch einzelne Kinder oder Jugendliche nicht ausgeschlossen werden können, vor allem im Zusammenhang mit Unterbringungen für kurze Zeit, vereinbarte der „Runde Tisch“, dass sich die Nachbarn bei Beschwerden sofort an die Leitung des KJND wenden oder/und Anzeige bei der Polizei erstatten.
Anlagen
6
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode
Drucksache 16/5909 Anlage 1 zur Antwort des Senats
7
Drucksache 16/5909
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode noch Anlage 1 zur Antwort des Senats
8
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode
Drucksache 16/5909
noch Anlage 1 zur Antwort des Senats
9
Drucksache 16/5909
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode noch Anlage 1 zur Antwort des Senats
10
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode
Drucksache 16/5909
noch Anlage 1 zur Antwort des Senats
11
Drucksache 16/5909
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode noch Anlage 1 zur Antwort des Senats
12
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode
Drucksache 16/5909
noch Anlage 1 zur Antwort des Senats
13
Drucksache 16/5909
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode noch Anlage 1 zur Antwort des Senats
14
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode
Drucksache 16/5909
noch Anlage 1 zur Antwort des Senats
15
Drucksache 16/5909
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode noch Anlage 1 zur Antwort des Senats
16
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode
Drucksache 16/5909
noch Anlage 1 zur Antwort des Senats
17
Drucksache 16/5909
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode noch Anlage 1 zur Antwort des Senats
18
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode
Drucksache 16/5909 Anlage 2 zur Antwort des Senats
19
Drucksache 16/5909
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode noch Anlage 2 zur Antwort des Senats
20
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode
Drucksache 16/5909 noch Anlage 2 zur Antwort des Senats
21
Drucksache 16/5909
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 16. Wahlperiode noch Anlage 2 zur Antwort des Senats
22