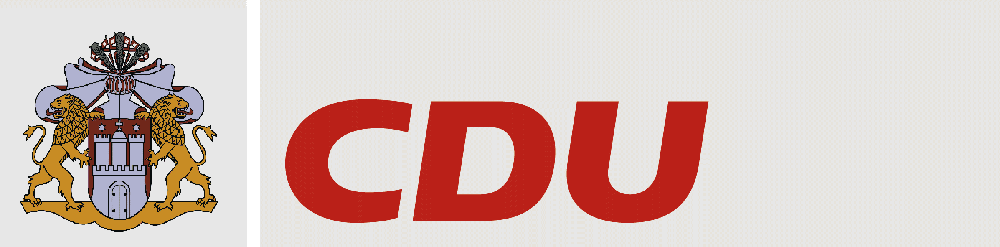Elektromobilität und Wasserstoffnutzung in Hamburg
BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG 20. Wahlperiode
Drucksache
20/1097
19.08.11
Große Anfrage
der Abgeordneten Karin Prien, Klaus-Peter Hesse, Thomas Kreuzmann, Hjalmar Stemmann, Birgit Stöver, Andreas C. Wankum (CDU) und Fraktion vom 25.07.11 und
Antwort des Senats
Betr.:
Elektromobilität und Wasserstoffnutzung in Hamburg Die Freie und Hansestadt Hamburg ist in diesem Jahr „Europäische Umwelthauptstadt“ und eine von insgesamt acht Modellregionen im Rahmen des Nationalen Entwicklungsplanes Elektromobilität in Deutschland. Bereits bis zum Sommer diesen Jahres sollen in Hamburg an bis zu 50 Standorten im Straßenraum, in städtischen Parkhäusern oder auf öffentlichen Park-andride-Flächen Stromladesäulen für Elektroautos durch die Stadt Hamburg sowie bis zu 150 Ladesäulen in Kooperation mit gewerblichen Partnern (Einzelhandelsketten, Parkhausbetreibern und Energieversorgern) errichtet werden. Die Bundesregierung hat am 18.05.2011 ein neues Regierungsprogramm Elektromobilität verabschiedet, welches dazu beitragen soll, Deutschland dem Ziel näherzubringen, bis zum Jahre 2020 1 Million Elektrofahrzeuge auf unsere Straßen zu bringen. Die Bundesrepublik ist auf dem Weg, im Bereich Elektromobilität weltweit eine Spitzenstellung einzunehmen. Dabei soll der Grundsatz gelten, dass Markt und Wettbewerb die besten Treiber für Innovationen sind. Am 28.06.2011 teilte das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der nachhaltigen Mobilität, der Energieeffizienz und der innovativen Verkehrstechnologie mit China mit. Zentraler Bestandteil der Erklärung ist die vertiefte Zusammenarbeit im Bereich Elektromobilität mit Batterie und Brennstoffzelle. Diese soll insbesondere im Rahmen eines breit angelegten Austausches zwischen insgesamt drei deutsch-chinesischen Modellstädten und Regionen erfolgen. Auf deutscher Seite beteiligt sich ebenfalls die Modellregion Hamburg. Die Hamburg Port Authority verhandelte laut Medienberichten („Hamburger Abendblatt“ vom 16.12.2010) bereits im Jahr 2010 mit dem ElektromobilitätsUnternehmen „Better Place“ über eine Ansiedlung im Hamburger Hafen. Darüber hinaus verkehren bereits seit fast sieben Jahren Wasserstoffbusse und seit 2010 Dieselhybridbusse in der Hansestadt, die die Innenstadtbereiche mit den Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs bedienen. Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat:
Drucksache 20/1097
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
Der Senat beantwortet die Fragen teilweise auf der Grundlage von Auskünften der Hamburg Port Authority (HPA), der hySOLUTIONS GmbH, den staatlichen Hamburger Hochschulen, der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg und des Helmholtz-Zentrums Geesthacht wie folgt: I. Förderung und Forschung Elektromobilität 1. Wie beurteilt der Senat das weitere Potenzial des Technologiebereichs „Elektromobilität“ in Hamburg?
Der Senat sieht in der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie und in der batteriebetriebenen Elektromobilität beträchtliche Zukunftspotenziale und Chancen für den Standort Hamburg. Diese Technologien bieten vielfältige Ansätze, um in Hamburg dauerhaft zum Erreichen der Klimaschutzziele, zur Minderung von Lärm- und Luftbelastungen und zu lokaler Innovationskraft und Wertschöpfung beizutragen. Wachstumsimpulse können gestärkt, die urbane Lebensqualität gesteigert und somit die Attraktivität des Standorts erhöht werden. Brennstoffzellen und Batterieantriebe werden als Technologieansätze gesehen, die sich sinnvoll ergänzen können. Die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie ermöglicht höhere Reichweiten und Anwendungsfälle (öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Personenkraftwagen (Pkw) im Überlandverkehr). Sie deckt damit Einsatzbereiche ab, die für Batteriesysteme derzeit nicht in Betracht kommen. 2. Wie viele Unternehmen aus dem Bereich „Elektromobilität“, differenziert nach ihrer Größe gemessen am Umsatz und der Anzahl ihrer Mitarbeiter, sind in der Freien und Hansestadt Hamburg und der Metropolregion Hamburg bereits heute tätig? Wie ist der Sachstand zur Ansiedlung des Elektromobilitäts-Unternehmens „Better Place“ auf welchen Flächen im Hamburger Hafen? Ist die Ansiedlung von diesem und vergleichbaren Unternehmen in dem letzten Entwurf des Hafenentwicklungsplans hinterlegt? Wenn ja, mit welchem Inhalt und auf welchen Flächen – wenn nein, warum nicht? Die HPA befindet sich nach wie vor in Verhandlungen mit Better Place über eine mögliche Ansiedlung des Unternehmens am Standort Hamburg. Aussagen zur Ansiedlung einzelner Unternehmen sind nicht Gegenstand des Hafenentwicklungsplans. Die HPA hat im besagten Entwurf des Hafenentwicklungsplans zum Ausdruck gebracht, dass die Ansiedlung von zukunftsorientierten Industrien, unter anderem auch Elektromobilität, Teil der strategischen Ausrichtung des Hamburger Hafens ist. 4. Welche universitären oder außeruniversitären Forschungsinstitute sind heute in Hamburg mit dem Bereich Elektromobilität befasst?
Hierzu liegen der zuständigen Behörde keine Erkenntnisse vor. 3.
Mit der Forschung in den Bereichen Elektromobilität und wasserstoffbetriebener Fahrzeuge befassen sich heute von den staatlichen Hamburger Hochschulen sowie von den weiteren in Hamburg ansässigen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Universität Hamburg (UHH), die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW), die Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg (HSU) und das Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG). 5. In welcher Höhe fließen Forschungsmittel aus dem nationalen „Entwicklungsplan Elektromobilität“ an Hamburger Unternehmen oder universitäre beziehungsweise außeruniversitäre Einrichtungen? Um welche Unternehmen handelt es sich hierbei?
Die Maßnahmen, mit denen die Ziele des Entwicklungsplans Elektromobilität umgesetzt werden sollen, wurden aus Mitteln des Konjunkturpakets II finanziert. Aus diesen Bundesmitteln erhalten die projektbeteiligten Kooperationspartner in den Jahren 2010
2
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
Drucksache 20/1097
und 2011 eine anteilige Förderung auf die nachgewiesenen Kosten in Höhe von insgesamt rund 12,5 Millionen Euro. Da diese Förderung eine Rechtsbeziehung zwischen Dritten begründet, wird grundsätzlich davon abgesehen, diesbezügliche Einzelheiten zu benennen. 6. In welchem Umfang fließen Investitionsmittel aus dem nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität und an wen im Einzelnen?
Aufseiten der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) wurde bei den projektbeteiligten Dienststellen und Unternehmen eine anteilige Bundesförderung in Höhe von 2.020.000 Euro realisiert (FHH: rund 155.000 Euro, HOCHBAHN: rund 1.350.000 Euro, HAMBURG ENERGIE: rund 515.000 Euro). Im Übrigen siehe Antwort zu 5. 7. Welche Anstrengungen unternimmt der Senat, um zusätzliche Mittel aus dem neuen Regierungsprogramm Elektromobilität nach Hamburg zu holen?
Die zuständige Behörde prüft gegenwärtig, ob und wie sich die FHH an der Fortführung der spezifischen Förderprogramme des Bundes in den Fachministerien wie auch an den im Regierungsprogramm Elektromobilität benannten übergeordneten Förderprogrammen beteiligen kann. 8. Hamburg ist neben London, Stockholm, Amsterdam, Wien, Paris, Barcelona, Berlin und Rom ebenfalls Partner im Projektkonsortium des hochkarätigen Städtebündnisses auf europäischer Ebene für den Zeitraum 2011 – 2014. Wie ist hier der Stand der Beantragung und der Zusagen von Fördermitteln?
Die Fragestellung bezieht sich auf ein Fördervorhaben, das bei den zuständigen Stellen der Europäischen Union (EU) beantragt, dort jedoch insgesamt nicht zur Förderung angenommen wurde. Dieses Projekt wird somit nicht umgesetzt. 9. Erwägt der Senat eine neue Brancheninitiative „Elektromobilität Hamburg“? Wenn ja, wann und mit welchen Instrumenten? Wenn nein, warum nicht? 10. Plant der Senat, zusammenhängende Gewerbeflächen zur Ansiedlung von Unternehmen der Elektromobilität auszuweisen, um so Synergieeffekte zu schaffen nach dem Vorbild des Technologieparks CFK in Stade? Hiermit hat sich der Senat bislang nicht befasst. II. Infrastruktur Elektromobilität 11. Wie viele Stromladesäulen für Elektroautos wurden an welchen Standorten im Straßenraum bislang realisiert? Bitte nach Art des Standortes (Parkhäuser, Park-and-ride-Anlagen und so weiter) sowie nach städtischem Betreiber oder Privatbetreiber aufschlüsseln. 12. Wie viele Stromladesäulen für Elektroautos sollen insgesamt hergestellt beziehungsweise eingerichtet werden? Bitte nach Art des Standortes (Parkhäuser, Park-and-ride-Anlagen und so weiter) sowie nach städtischem Betreiber oder Privatbetreiber aufschlüsseln. Im Rahmen des Verbundvorhabens „Einsatz von elektrisch angetriebenen Pkw und Aufbau von Ladeinfrastruktur in der Modellregion Hamburg“ sollten im öffentlichen Raum insgesamt 50 Ladesäulen für bis zu 100 Ladeplätze errichtet werden. An insgesamt 49 Standorten sind bereits Ladesäulen eingerichtet, ein weiterer Standort im öffentlichen Straßenraum befindet sich in Abstimmung. Ladeplätze im öffentlichen Straßenraum: Adresse Betreiber Erik-Blumenfeld-Platz 9 HAMBURG ENERGIE GmbH
3
Drucksache 20/1097
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
Adresse Alter Wall Heiligengeistbrücke Glockengießerwall Holstenplatz Alsterufer Kattrepel Stormarnplatz Garstedter Weg Moorweidenstraße Hallerstraße Bornstraße Feldstraße ABC-Straße Büschstraße Osakaallee Gertrudenkirchhof Hachmannplatz Königstraße Dragonerstall Kattjahren Schwarzenbergstraße Sand Vierlandenstraße Schulenbrooksweg Henriettenstraße Grindelberg Elbchaussee Essener Bogen Bebelallee Lehmweg Kümmellstraße Eduard-Rhein-Ufer Max-Brauer-Allee Schillerstraße Großer Schippsee II Palmaille An der Alster II Zum Handwerkszentrum Bodestraße Steindamm Wandsbeker Königstraße Stein-Hardenberg-Straße Borgweg
Betreiber 12 Vattenfall Europe AG 2 HAMBURG ENERGIE GmbH 22 – 26 HAMBURG ENERGIE GmbH 14 Vattenfall Europe AG 2 Vattenfall Europe AG 14 Vattenfall Europe AG 1 Vattenfall Europe AG 4 Vattenfall Europe AG 22 Vattenfall Europe AG 85 HAMBURG ENERGIE GmbH 6 HAMBURG ENERGIE GmbH 51 Vattenfall Europe AG 52 Vattenfall Europe AG 12 Vattenfall Europe AG 6 HAMBURG ENERGIE GmbH 8 – 10 Vattenfall Europe AG 2 Vattenfall Europe AG 4 Vattenfall Europe AG 13 HAMBURG ENERGIE GmbH 4 Vattenfall Europe AG 93 Vattenfall Europe AG 13 HAMBURG ENERGIE GmbH 5 Vattenfall Europe AG 1 HAMBURG ENERGIE GmbH 77 HAMBURG ENERGIE GmbH 66 HAMBURG ENERGIE GmbH 139 Vattenfall Europe AG 1 HAMBURG ENERGIE GmbH 1 HAMBURG ENERGIE GmbH 27 Vattenfall Europe AG 5 HAMBURG ENERGIE GmbH 1 Vattenfall Europe AG 54 HAMBURG ENERGIE GmbH 44 Vattenfall Europe AG HAMBURG ENERGIE GmbH Vattenfall Europe AG 65 HAMBURG ENERGIE GmbH 1 HAMBURG ENERGIE GmbH 10 Vattenfall Europe AG 94 HAMBURG ENERGIE GmbH 9 HAMBURG ENERGIE GmbH HAMBURG ENERGIE GmbH 10 HAMBURG ENERGIE GmbH
Ladeplätze in Park-and-ride-Anlagen: Adresse Betreiber Harburger Chaussee 17 Vattenfall Europe AG Lattenkamp Vattenfall Europe AG Kiwittsmoor Vattenfall Europe AG Berner Heerweg 327 HAMBURG ENERGIE GmbH Ohnhorststraße HAMBURG ENERGIE GmbH
4
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
Drucksache 20/1097
Im Übrigen liegen der zuständigen Behörde keine Erkenntnisse über die Ladeinfrastruktur im privaten Raum vor. 13. Wann sollen die Baumaßnahmen komplett abgeschlossen sein? Die Baumaßnahmen im Rahmen des Verbundvorhabens „Einsatz von elektrisch angetriebenen Pkw und Aufbau von Ladeinfrastruktur in der Modellregion Hamburg“ werden bis 30. September 2011 abgeschlossen sein. 14. Welche Unternehmen beteiligen sich zum Beispiel in Public Private Partnership mit welchen Beiträgen an dem Modellprojekt Elektromobilität? An dem Modellvorhaben beteiligen sich im Bereich der Infrastruktur die beiden Unternehmen HAMBURG ENERGIE GmbH und Vattenfall Europe Innovation GmbH, die jeweils die Hälfte des realisierten Ladesäulenkontingents im öffentlichen Raum in ihrer Verantwortung betreiben. 15. Welche Voraussetzungen müssen die Verbraucher für die Nutzung der Stromladesäulen erfüllen? Gibt es Unterschiede je nach Art des Standortes? Bitte für die einzelnen Standorte aufschlüsseln. Zur Nutzung aller Ladesäulen, die im Rahmen des Verbundvorhabens im öffentlichen Raum errichtet wurden, wird von den Verbrauchern zur Authentifizierung und Abrechnung des Ladestroms eine Chipkarte benötigt. Über die Voraussetzungen für die Nutzung von Ladesäulen im privaten Raum liegen der zuständigen Behörde keine Kenntnisse vor. 16. Ist ein Rahmenvertrag mit einem Energieversorger für die Nutzung von Stromladesäulen Voraussetzung? Wenn ja, wie gestalten sich die einzelnen Tarife? Bitte nach Anbietern getrennt aufschlüsseln. Die für die Nutzung von Ladesäulen im öffentlichen Raum erforderliche Chipkarte erhalten die Verbraucher von einem Stromanbieter ihrer Wahl, der ein Autostromprodukt mit zertifiziertem Grünstrom anbietet. Hierfür ist ein Autostromvertrag abzuschließen. Die Tarifgestaltung für Autostromprodukte an der öffentlichen Ladeinfrastruktur liegt in der Zuständigkeit der Stromanbieter. 17. Wie viel kostet eine Kilowattstunde Strom an einer Ladesäule zum jetzigen Zeitpunkt? Existieren unterschiedliche Anbieter und wenn ja, welche und zu welchem Preis bieten diese Strom an den Ladesäulen an? Siehe Antworten zu 11. und 12. sowie 16. 18. Es sollten zunächst 50 Fahrzeuge der Marke Daimler smart zum Einsatz kommen. Ist die Zahl 50 erreicht worden und ist diese sogar übertroffen worden? Welche Erfahrungen sind zu benennen? Diese Zahl ist übertroffen worden. Neben den 50 Fahrzeugen vom Typ „smart fortwo electric drive“ werden bis zu 18 weitere Fahrzeuge vom Typ Mercedes A-Klasse „ECell“ im Projekt zum Einsatz kommen. Sämtliche Fahrzeuge werden bei gewerblichen Fuhrparkbetreibern erprobt. Die Erfahrungen werden dokumentiert und extern evaluiert. Die Fahrzeuge werden überwiegend im gewerblichen Bereich erprobt. 19. Welche Angebote – insbesondere der UmweltPartnerschaft Hamburg – existieren im Bereich der betrieblichen Mobilität in Bezug auf Fuhrparkmanagement, ÖPNV-Nutzung, Fahrertrainings sowie im Allgemeinen? 20. Wie sollen diese Angebote weiter ausgebaut werden? Im Programm „Unternehmen für Ressourcenschutz“ der zuständigen Behörde werden Hamburger Unternehmen Beratungen und finanzielle Förderungen für die Einführung von Fuhrparkmanagementsystemen einschließlich Fahrertraining angeboten.
5
Drucksache 20/1097
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
Im Zusammenhang mit der Fortschreibung der UmweltPartnerschaft Hamburg wird durch die zuständige Behörde die Möglichkeit weiterer Aktivitäten im Bereich der umweltfreundlichen Mobilität geprüft werden. 21. Welche Behörde ist zuständig und welche Behörde wird künftig zuständig sein? Die federführende Zuständigkeit für das Thema Elektromobilität liegt seit Kurzem bei der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation. Eine weitere Änderung ist derzeit nicht geplant. 22. Im Wirtschaftsverkehr sollen im Kleinsegment für kleine oder mittlere Transportkapazitäten im Rahmen des Projektes circa 20 Renault Kangoo sowie circa 20 Fiat Fiorino eingesetzt werden. Wie viele sind derzeit jeweils im Einsatz? Derzeit sind 15 Fahrzeuge vom Typ „Renault Kangoo ZE“ und 20 Fahrzeuge vom Typ „Karabag E-Fiorino“ im Einsatz. 23. Im mittleren Transportsegment sind zum Beispiel Mercedes Vito oder Ford Transit für den Einsatz geeignet. Wie viele sind bereits im Einsatz oder ab wann ist mit deren Einsatz zu rechnen? Es sind in diesem Fahrzeugsegment in Hamburg Fahrzeuge vom Typ „Mercedes EVito“ im Einsatz, deren Anzahl in diesem Jahr auf bis zu 30 Fahrzeuge erhöht werden soll. Ab Oktober werden zusätzlich voraussichtlich 15 Fahrzeuge vom Typ „Karabag Ducato electric“ zum Einsatz kommen. 24. Welche Unternehmen oder Institutionen sind Partner beim Einsatz von E-Mobilen im Wirtschaftsverkehr? Derzeit sind folgende Unternehmen und Institutionen Partner: Airbus, Aurubis, Axel-Springer-Verlag, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Beiersdorf, Buddenhagen, Budnikowsky, Deutsche Bahn/Deutsche Bahn Rent, Finanzbehörde, Flughafen Hamburg, Globetrotter Ausrüstung, HAMBURG ENERGIE, Hamburg Port Authority, HAMBURG WASSER, Hamburger Morgenpost Verlag, Handelskammer Hamburg, Handwerkskammer Hamburg, Hermes Logistik, Hamburger Hafen und Logistik AG, Hillmann & Ploog, HOCHBAHN, internationale gartenschau hamburg 2013 gmbh, Imtech, Innung des Kraftfahrzeug-Handwerks, Institut für Umwelt und Hygiene, Itzehoer Versicherungen, KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs AG, Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer, Lesezirkel LESERKREIS DAHEIM, Otto Group, Panasonic Europe, Stadtreinigung Hamburg, STARCAR, Stevens Bike Company, Tchibo, Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) Nord, TÜV Rheinland, Unilever, Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf, Vattenfall Europe, Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein/Pinneberger Verkehrsgesellschaft Unternehmensgruppe. Im Übrigen siehe www.elektromobilitaethamburg.de. 25. Gibt es Sondernutzungsrechte im Straßenverkehr für Elektromobile, wie zum Beispiel das kostenfreie Parken? Wenn ja, welche, wenn nein, plant der Senat deren Schaffung? Für die Ladeplätze, die im Rahmen des Verbundvorhabens „Einsatz von elektrisch angetriebenen Pkw und Aufbau einer Ladeinfrastruktur in der Modellregion Hamburg“ geschaffen wurden, bestehen keine Sonderrechte nach Straßenverkehrsrecht, sondern die Erlaubnis zur Sondernutzung gemäß § 19 Hamburgisches Wegegesetz. Die betroffenen Stellplätze sind damit dem Gemeingebrauch entzogen und stehen als kostenfreie Ladeplätze für Elektrofahrzeuge auch in solchen Bereichen zur Verfügung, in denen das Parken ansonsten gebührenpflichtig oder nur mit Parkscheibe zulässig ist. 26. Gibt es Überlegungen, zur Reduktion der ladebedingten Standzeiten von Elektrofahrzeugen ein Leih- und Rückgabesystem für Batterien in Elektrofahrzeugen einzuführen oder zu erproben, wie dies in Dänemark derzeit der Fall ist?
6
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
Drucksache 20/1097
Wenn ja, wann und in welchem Umfang soll die Erprobung beginnen und stattfinden? Wenn nein, warum nicht? Hiermit hat sich der Senat noch nicht befasst. III. Infrastruktur Wasserstoff 27. Wie beurteilt der Senat das Potenzial der Nutzung von Wasserstoff als alternativer Antriebsmöglichkeit im Vergleich zur Elektromobilität? Siehe Antwort zu 1. 28. Welche universitären oder außeruniversitären Forschungsinstitute sind heute in Hamburg mit dem Forschungsbereich wasserstoffbetriebener Fahrzeuge befasst? Siehe Antwort zu 4. 29. Wie viele Wasserstofftankstellen an welchen Standorten existieren in Hamburg? Durch wen wurden diese Tankstellen errichtet und wer betreibt sie zurzeit? Es bestehen derzeit in Hamburg drei Wasserstofftankstellen, die sich jeweils auf öffentlich nicht zugänglichem Betriebsgelände befinden. Es handelt sich um die folgenden Standorte: Standort: Errichtet durch: HOCHBAHN HOCHBAHN Betriebshof Hummelsbüttel Flughafen Hamburg Flughafen Hamburg GmbH HOCHBAHN Betriebsgelände Hellbrookstraße Alster-Touristik GmbH (ATG) Betrieben durch: HOCHBAHN Flughafen Hamburg GmbH LINDE
30. Welche Unternehmen beteiligen sich zum Beispiel in Public Private Partnership mit welchen Beiträgen an dem Bau von Wasserstofftankstellen und der Nutzung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen in Hamburg? Im Rahmen einer Public Private Partnership beteiligen sich die Unternehmen Shell, TOTAL und Vattenfall als Kooperationspartner der FHH an der Errichtung und Inbetriebnahme von insgesamt fünf Wasserstofftankstellen in Hamburg. An der Nutzung der Fahrzeuge sind neben dem städtischen Unternehmen HOCHBAHN auch größere Industriekonzerne wie Airbus oder Linde oder Wirtschaftsunternehmen wie Imtech beteiligt. 31. Welche wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge nutzen die Freie und Hansestadt Hamburg und ihre städtischen Unternehmen in ihren Fuhrparks und welcher Art sind diese Fahrzeuge im Einzelnen? Die HOCHBAHN nutzt seit August 2011 vier wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenhybridbusse. Darüber hinaus befindet sich bei der HOCHBAHN ein wasserstoffbetriebener Brennstoffzellen-Pkw vom Typ Mercedes B-Klasse „F-Cell“ im Einsatz. 32. Plant der Senat die Ausweitung der Nutzung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen im Fuhrpark der Freien und Hansestadt Hamburg und ihrer öffentlichen Unternehmen? 33. Plant der Senat die Schaffung von Sondernutzungsrechten im Straßenverkehr für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, wie zum Beispiel das kostenfreie Parken? Hiermit hat sich der Senat noch nicht befasst. 34. Gibt es Überlegungen, eine Wasserstoff-Pipeline von Stade nach Hamburg zu bauen?
7
Drucksache 20/1097
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
Wenn ja, wie weit sind die Planungen vorangeschritten? Mit welchen Teilnehmern wurden wann Gespräche über den Bau und die Lieferung von Wasserstoff durch diese Pipeline geführt? Welche Kosten werden hierdurch verursacht und wer trägt diese? Wie soll der hierdurch in die Hansestadt transportierte Wasserstoff verwendet werden? Stünde er für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge zur Verfügung? Nein. IV. Infrastruktur Dieselhybridbusse 35. Wie beurteilt der Senat das Potenzial der Nutzung von Dieselhybridbussen als Ergänzung zur Elektromobilität? Bei einem Einsatz im Stadtverkehr können insbesondere serielle Dieselhybridbusse zur Reduzierung des Treibstoffverbrauchs einen Beitrag leisten. Außerdem können sie auf geeigneten Streckenabschnitten rein elektrisch und damit leise betrieben werden. Parallele Dieselhybridbusse sind besser für Linien mit höheren Durchschnittsgeschwindigkeiten und längeren Haltestellenabständen geeignet. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine wachsende Zahl von Verkehrsunternehmen ab etwa 2015 sukzessive ihre Busflotten auf Hybridfahrzeuge umstellen wird, wenn diese zu angemessenen wirtschaftlichen Konditionen eingesetzt werden können. In den zurückliegenden Monaten hat die HOCHBAHN fünf serielle Dieselhybridbusse erprobt. Der Praxisbetrieb hat gezeigt, dass noch weitere Optimierungspotenziale zu erschließen sind, um eine echte Marktreife von Dieselhybridbussen zu erreichen. Bei Tochtergesellschaften der HOCHBAHN werden künftig auch Dieselbusse mit parallelem Hybridantrieb erprobt. 36. Welche universitären oder außeruniversitären Forschungsinstitute sind heute in Hamburg mit der Erforschung von Dieselhybridantrieben befasst? Mit der Erforschung von Dieselhybridantrieben befasst sich heute von den in Hamburg ansässigen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ausschließlich die HSU. Eine Erforschung in diesem Bereich durch staatliche Hamburger Hochschulen erfolgt zurzeit nicht. 37. Welche Unternehmen beteiligen sich zum Beispiel in Public Private Partnership mit welchen Beiträgen an der Nutzung von hybridbetriebenen Fahrzeugen in Hamburg? Hierzu liegen der zuständigen Behörde keine Erkenntnisse vor. 38. Wie viele Dieselhybridfahrzeuge sind bei der Freien und Hansestadt Hamburg und ihren städtischen Unternehmen in ihren Fuhrparks im Einzelnen vorhanden? Dieselhybridfahrzeuge werden bei den nachstehend genannten städtischen Unternehmen eingesetzt: Hamburger Hochbahn: Süderelbe Bus GmbH: igs hamburg 2013 gmbh: Stadtreinigung Hamburg: 5 Fahrzeuge 2 Fahrzeuge 1 Fahrzeug 1 Fahrzeug.
39. Plant der Senat die Ausweitung der Nutzung von dieselhybridbetriebenen Fahrzeugen im Fuhrpark der Freien und Hansestadt Hamburg und ihrer öffentlichen Unternehmen? Der Senat hat am 5. Juli 2011 die „Leitlinie für die Beschaffung von Fahrzeugen mit geringen CO2- und Schadstoffemissionen“ beschlossen. Hiernach sollen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben verstärkt in die Beschaffungsplanung einbezogen werden. Insofern werden bei Beschaffungsvorhaben auch Dieselhybridfahrzeuge in die Planung und Entscheidung einbezogen.
8